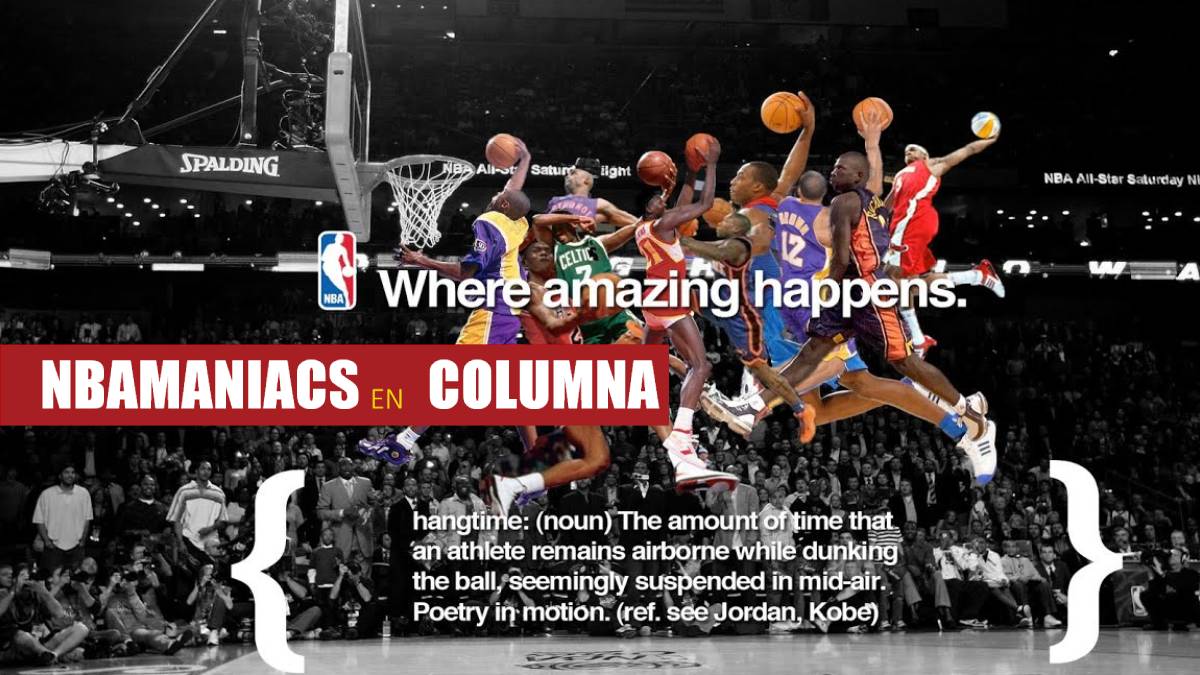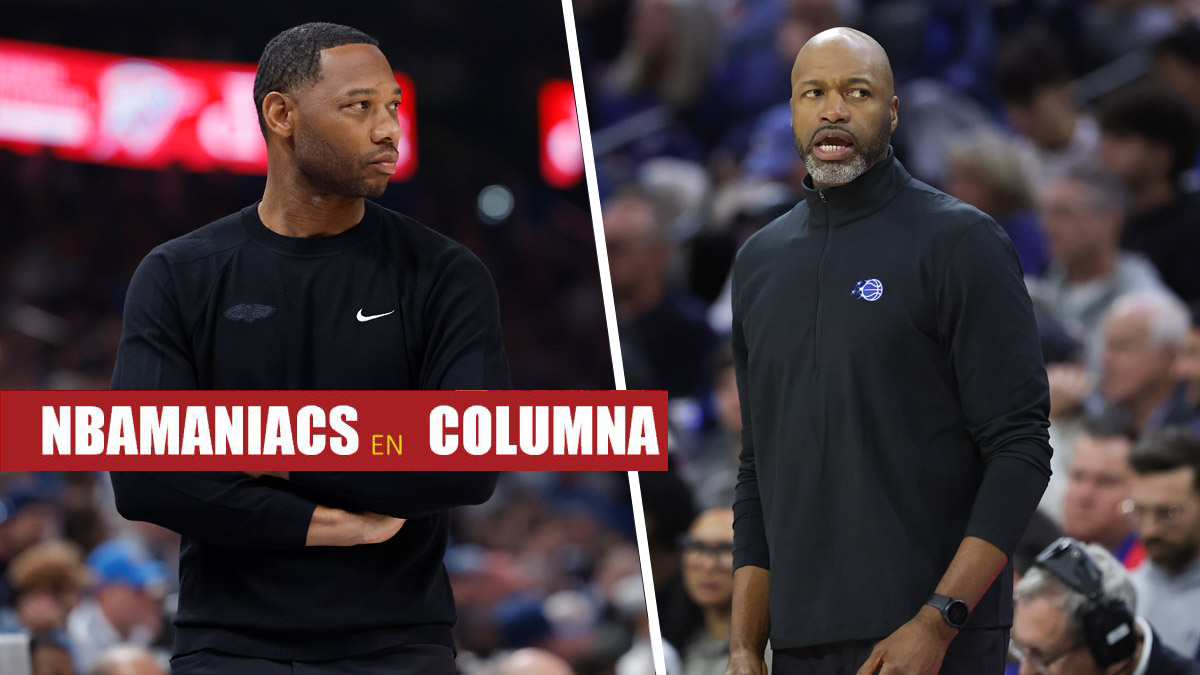Früher Morgen. Das Adrenalin des Verbotenen. Ein Röhrenfernseher, so leise gestellt, dass niemand, der noch schlief, davon aufwachte, aber dafür auf voller Helligkeit. Der Bildschirm flackerte in Farben, die es bis dahin nur in Zeichentrickfilmen gab. Die Körper, die sich in diesem Kaleidoskop aus Spielfeld und Zuschauerinnen und Zuschauern bewegten, tanzten zugleich anmutig und wild. Es wirkte völlig anders. Wie ein Blick in eine andere Welt. Kaum zu glauben, dass es real war.
Damals ahnte die NBA nicht, wie sich ihr Slogan in den USA auswirken würde. Trotzdem begann sie, genau diesen Werbespruch zu nutzen, um ihr Produkt über den Atlantik zu verkaufen: „Where amazing happens.“ Manche mochten das abgedroschen finden – reine Werbephrasen. Doch hier trafen diese drei Worte das Gefühl all jener, die sich von einer Liga angezogen fühlten, in deren drei Buchstaben ein Hauch von Magie mitschwang.
„Amazing“, was auf Spanisch „increíble“ bedeutet, war das perfekte Wort. Denn es war wirklich schwer zu glauben, dass Menschen tatsächlich zu den Dingen fähig sein sollten, die wir in diesen kurzen Top-10-Clips, den All-Star-Highlights oder den Dokumentationen sahen. Die vorherige Generation hatte deren leibhaftige Wirklichkeit in Barcelona ’92 erlebt. Meine Generation konnte nicht fassen, wie ein Junge aus Barcelona sich mit den Außerirdischen messen konnte.
Heute laufen wir Gefahr, das Unglaubliche nicht mehr zu glauben.
Spekulationen auf Eis gelegt
Das ist nichts Neues. Der Massensport war schon immer in gewissem Maß von Spielabsprachen und Wettbetrug geprägt. Der Aufstieg dieses Slogans fiel zeitlich zusammen mit dem Tim-Donaghy-Skandal, bei dem ein NBA-Schiedsrichter zugab, in den frühen 2000ern Spiele manipuliert zu haben. Als Michael Jordan fast schon göttlich wirkte, zeigte er seine menschliche Seite durch seine Spielsucht. Jack Molinas setzte der frühen NBA in den 50ern mit seiner Wettleidenschaft zu. Und das sind nur die berüchtigtsten Beispiele in der besten Basketball-Liga der Welt.
Im Grunde ist es ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte übermäßiger Leidenschaften in den Vereinigten Staaten.
Niemals zuvor jedoch war die Fähigkeit der Fans, an das Unglaubliche zu glauben, so sehr auf die Probe gestellt. Sie wird verzerrt durch die allgegenwärtige Spekulation, die sich in verschiedenen Formen zeigt.
Wenn du noch regelmäßig bei Twitter (offiziell X) reinschaust und in Spanien lebst, weißt du genau, wovon ich rede. Wer sich für Sport interessiert, kommt nicht drum herum, auf Posts zu treffen, die Wettbewerbe als manipuliert bezeichnen.
Der angebliche Schiedsrichter-Betrug dominiert die Analysen und hat auch das Internet durchdrungen, das einmal als Rückzugsort gedacht war. Zufällig fühlen sich plötzlich alle betrogen. Im Fußball war es bis vor ein paar Jahren ein Leichtes, sich innerlich von Leuten abzugrenzen, die an große Verschwörungen ohne Belege glaubten. Seit dem „Caso Negreira“ erscheint das jedoch begründet und nimmt noch mehr Fahrt auf.
Zu glauben, dass – wenn der eine betrügt – auch alle anderen betrügen, vergiftet unser Zusammenleben; in diesem Zusammenhang untergräbt es die Leidenschaft für den Massensport. Und es ist leider unvermeidlich.
Vom Bildschirm aufs Parkett
Ein Teil der Diskussion im Netz dreht sich um die äußere Gamification des Sports: das Spiel um das Spiel. Häufig gibt man sich als harmlose Fantasy-League aus, um zu verschleiern, dass Sport längst nicht mehr so betrachtet wird wie früher. Wer schon mal in einer dieser digitalen Zockerrunden mit Freundinnen oder Freunden war, weiß, was ich meine. Wir sehen nicht mehr nur die Spieler, sondern auch die Leistung eines hypothetischen Angestellten. Und das ist nicht weit weg davon, reales Geld darauf zu setzen, ob ein Spieler punktet, noch vor der 20. Minute eine Gelbe Karte kassiert oder sein Over/Under bei Rebounds erreicht.
Wetten müssen nicht zwangsläufig Leben zerstören, um unsere Haltung zum Sport zu vergiften. Wer hat nicht schon mal jemanden sagen hören, dass er ein paar Euro auf ein Spiel setzt, um die Spannung hochzuschrauben? Das ist nur eine der Gefahren, wenn in einem kapitalistischen Wettbewerb alles auf „Entertainment“ ausgerichtet wird.
In letzter Zeit haben Wettende ihr Versteck hinter den Bildschirmen verlassen und tauchen direkt im Leben der Spieler auf. Auch NBA-Stars gehen ins Twitter und sehen, wie ihre Feeds von Wettinhalten überflutet werden. Direkt hinter jeder Bank hörst du Leute, die sich als Fans ausgeben und ihre Wettscheine Richtung Spieler oder Coaches rufen, um sie zu beeinflussen. Wir Außenstehenden können nur hoffen, dass dieser Einfluss nicht unbemerkt in ihren Köpfen weiterarbeitet.
Inzwischen haben die meisten wohl das Video von Terry Rozier gesehen, in dem er gegen die Cleveland Cavaliers so schlecht spielt, dass es fast unmöglich erscheint, darin keine absichtliche Stat-Manipulation zu vermuten.
„CalienteDeMiami“, ein Stammleser dieser Website, schrieb dazu, als die Nachricht bekannt wurde:
„Ich habe mir gerade das Video von Terry Rozier im HEAT-Trikot angesehen, wie er Spiele manipuliert… Er sollte unsere Farben nie wieder tragen, egal ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Raus mit diesem Betrüger aus dem HEAT.“
Genau an diesem Punkt fangen die Fäden an zu reißen, die die Show zusammenhalten. Soweit bekannt, ermittelt das FBI in Bezug auf dieses Spiel nicht gegen Rozier. Sogar in Fällen wie Jontay Porter – ein Spieler, der nur in der Ecke stehen müsste, um seine prognostizierten Punkte nicht zu erreichen – war der eigentliche Grund für seine Strafe das vorzeitige Verlassen der Partie mit einer angeblich erfundenen Verletzung, über die er Wettenden Bescheid gesagt hatte.
Anders gesagt: Wer seine Gesamtleistung drücken will, macht das meist nicht durch dämliche Ballverluste oder grausige Würfe. Er wirkt einfach weniger konzentriert oder täuscht eine Verletzung vor, um ausgewechselt zu werden.
In unserer alten Welt wäre Rozier in dem Clip eine der lustigsten „Shaqtin’ a Fool“-Szenen der Saison gewesen. Ein Teil der großen NBA-Show. Aber in einer Liga, die vom Wetten verschlungen wird, gelten Misstrauen und Argwohn plötzlich als berechtigt. Und das fügt sowohl dem Wettbewerb als auch dem Produkt Schaden zu, weil wir den kindlichen Blick auf das Spiel verlieren – einen Blick, in dem wir uns vermutlich alle einig sind, dass er die beste Annäherung an dieses Geschäft ist.
Es ist verstörend zu sehen, wie User vergangene Momente, die sie noch so lebhaft in Erinnerung haben, jetzt führend für offensichtliche Wettbetrügereien halten.
Darsteller in der Show
Wenn du es bis hierher geschafft hast, ist dir das Offensichtliche klar: Auch NBAMANIACS hat in einigen Inhalten Partnerschaften mit Wettanbietern. Und wir sind ehrlich gesagt zufrieden damit, wie wir diese Unternehmen einbinden – fokussiert auf eine bestimmte Art von Beiträgen und ohne aufdringliche Einbindung. Aber naiv sind wir nicht. Wir wissen, dass wir Teil des Problems sind.
Die Entscheidung, einen Deal mit dem Teufel einzugehen, war für uns von Beginn an der Preis dafür, dass du NBAMANIACS weiter wie bisher nutzen kannst, wir mehr Ressourcen für besondere Spezialberichte haben und wir Podcasts und Artikel ohne Paywall anbieten können. Rückblickend merke ich, dass ich dieselben Argumente benutze, die auch Adam Silver über die Transparenz seiner Allianzen mit FanDuel, ESPN Bet oder DraftKings anführt.
Jeder Sportjournalist und jede Sportjournalistin weiß vom ersten Tag an, dass wir im Grunde über Dinge berichten, die im großen Ganzen unbedeutend erscheinen. Wir leben in der Illusion, alles hinge von einem orangefarbenen Ball und einem Korb mit Netz ab. So lässt sich die reale Krise, die Spielsucht in vielen Bereichen der Gesellschaft auslöst, leicht ausblenden.
Wir sind hier, um dir den Tag ein wenig zu erhellen und dir das Spiel so zu zeigen, dass manchmal dieser kindliche Blick entsteht. Eigentlich müsste das leicht sein, wenn du Victor Wembanyama oder Stephen Curry siehst. Doch irgendwann wird es absurd, wenn wir nur kurz über das fragile Fundament nachdenken, auf dem das alles steht.
Als nach den Verhaftungen weitergespielt wurde, stellte sich ein ähnlich dumpfes Gefühl ein wie bei den Partien kurz nach dem Tod von Kobe Bryant. Soll man wirklich weitermachen?
Ein Riese mit Füßen aus Ton
Seit Donnerstag fordern viele den Rücktritt von Adam Silver. Das erscheint unmöglich, weil er gerade den TV-Deal abgeschlossen hat, der die NBA zur zweitreichsten Sportliga der Welt aufsteigen ließ – ein vorher nie erreichter Meilenstein.
Trotzdem steht der Commissioner vor seinem bisher größten öffentlichen Tiefpunkt. Seit Jahren bröckeln jene Werte, die die Liga einst zum Vorreiter im Sport machten. Geschäftliche Vereinbarungen mit Wettanbietern und enorm reichen, aber menschenrechtsfeindlichen Staaten oder sein schwaches Durchgreifen bei häuslicher Gewalt sind nur einige Punkte.
Wie beim Thema Manipulation stellen vermeintliche Skandale um Kawhi Leonard die heiligsten Pfeiler der Liga infrage: das Ideal von Chancengleichheit. Es war zwar nie ganz Wirklichkeit, doch es bildet den zentralen Grundgedanken dahinter. Nun geht es darum, wer diesen Grundgedanken offensichtlich ignoriert.
Die NBA betont gebetsmühlenartig, sie werde die Integrität des Wettbewerbs schützen, wohlwissend, dass die vermeintliche Reinheit längst Risse zeigt. Nichts ist für das Publikum fataler, als das Gefühl, dass das Unglaubliche vielleicht doch nicht geglaubt werden kann.
(Cover Foto mit freundlicher Genehmigung der NBA)